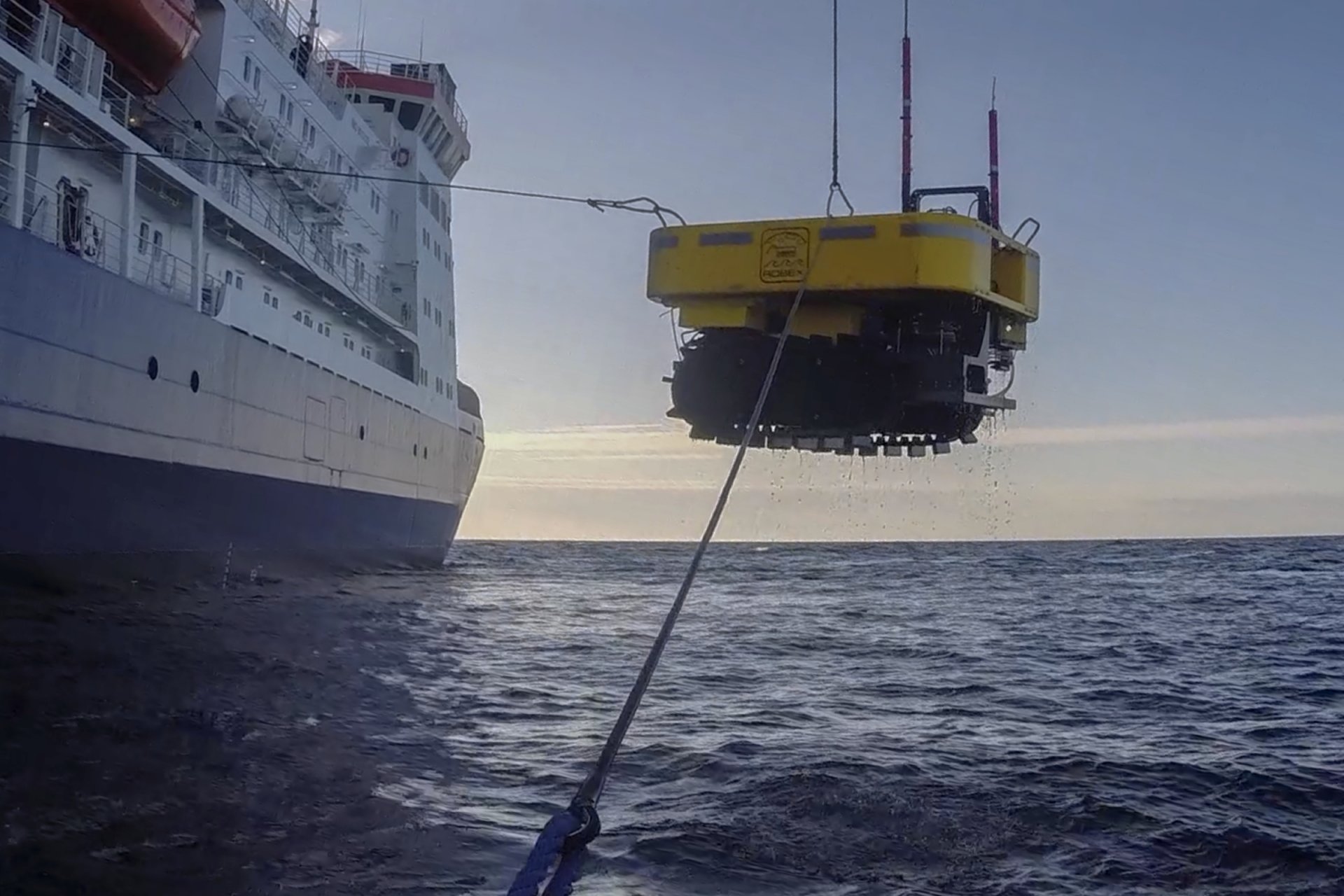- Presse
- Pressemeldungen 2019
- Mikrobiologie des globalen Wandels
Große Fragen zur Rolle mikroskopischen Lebens für unsere Zukunft
„Mikrobiologie des globalen Wandels“ nennt sich das Forschungsgebiet, welches sich mit mikrobiellen Reaktionen auf globale Erwärmung, Übernutzung und Umweltverschmutzung sowie mit Rückkopplungsmechanismen und -funktionen im Klimawandel befasst. Die international angesehene Fachzeitschrift „Nature Reviews Microbiology“ fragte Prof. Dr. Antje Boetius nach ihrer Einschätzung zu diesem Themengebiet: „Da Mikroorganismen eine große Auswirkung auf die Stoffkreisläufe, Produktivität und Gesundheit unseres Planeten wie auch auf uns Menschen haben, wird dieses Forschungsfeld wesentliche Kenntnisse für die Zukunft der Erde liefern“, so die Direktorin des Alfred-Wegener Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) und Gruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie.
Die Evolution des Lebens geht auf Mikroorganismen zurück, die seit über 3,8 Milliarden Jahren die Erde prägen und überhaupt erst die Lebensgrundlage für vielzellige Lebewesen und letztendlich auch den Menschen geschaffen haben. Jüngste globale Veränderungen deuten darauf hin, dass der Mensch eine neue geologische Ära eingeleitet hat: das „Anthropozän“. Dieser Begriff steht für die tiefgreifenden Auswirkungen des Menschen auf den Planeten, einschließlich seiner Kontinente, seiner Atmosphäre und der Ozeane. „Ein günstiges, stabiles Klima über 12.000 Jahre und Technologien, die auf vergleichsweise billig verfügbaren, natürlichen Energieressourcen wie Holz, Kohle, Öl und Gas basieren, haben es der menschlichen Bevölkerung ermöglicht, exponentiell zu wachsen. Erste Erkenntnisse zur Wechselwirkung des Klimas mit Mikroorganismen in Böden und im Wasser zeigen, dass die Rückkopplungseffekte nicht zu unseren Gunsten ausgehen. Wenn es wärmer wird, produzieren die Mikroben mehr Kohlendioxid (CO2). Das Ausmaß der Klima- und Umweltschäden sowie Artenverluste insgesamt macht es dringlich, unseren Pfad zu ändern“, argumentiert Tiefseeforscherin Antje Boetius.
Grundsätzlich lassen sich mehrere Rückkopplungseffekte feststellen, die die Umweltbelastung noch zusätzlich beschleunigen. Beispielsweise steigt die Produktion mikrobieller Treibhausgase auch mit zunehmender Landwirtschaft und Tierhaltung. In einigen Ozeanregionen scheint die biologische Pumpe schwächer zu werden. Krankheiten können sich über breitere Klimazonen ausbreiten. Mikroorganismen könnten aber auch ein Teil der Lösung bei der Suche nach nachhaltigen Energien und der Sanierung von Lebensräumen sowie der Gesundheit unseres Planeten und von uns Menschen sein: „Unser Wissen über die Vielfalt und Funktion von Einzellern wächst, geht jedoch zu oft nicht in die globale Synthese des Klima- und Umweltzustands und in den Wissenstransfer ein. Es sollte mehr dazu geforscht werden, wie die Eingriffe des Menschen mikrobielle Gemeinschaften verändern, und wie Mikroorganismen dazu beitragen können, nachhaltige Lösungen für die Bereiche Bioökonomie, Biotechnologie, Landwirtschaft, Ernährung, Energie, Gesundheit und Infrastruktur bieten können“, schreibt Boetius.
Es bleibe eine globale Aufgabe, die biologische Vielfalt der Erde einschließlich der Mikroorganismen und ihrer engen Wechselwirkungen zu bewerten, da künftige Generationen dieses Wissen für besseres Umweltmanagement benötigten, so Antje Boetius zum Start einer neuen Reihe zu „Mikrobiologie des globalen Wandels“ in der Juni-Ausgabe des Magazins Nature Reviews Microbiology.
Originalveröffentlichung
Rückfragen bitte an:
Pressereferentin
MPI für Marine Mikrobiologie
Celsiusstr. 1
D-28359 Bremen
|
Raum: |
1345 |
|
Telefon: |